Gendergerechte Sprache kommt langsam an der Uni an. Doch nicht überall. Dabei ist sie wichtiger, als so manche denken.
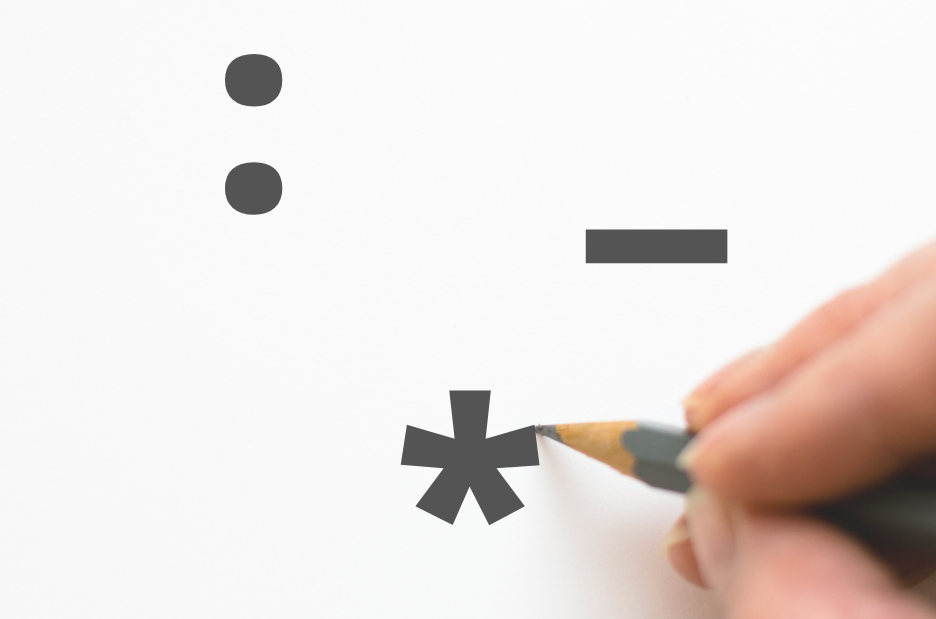
Ein Gastbeitrag von Milma Anton, Mitglied des Queer-Referats der Studierendenvertretung der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Mein Professor steht vorne und proklamiert voll Stolz in der ersten Vorlesung, dass Gendern für ihn nichts sei, er lasse da nicht mit sich reden, er halte nichts davon und seine Tochter versuche da eh schon ohne Erfolg ihn zu überzeugen. Er benutze weiter das generische Maskulinum, streue manchmal die feminine Form ein und man solle sich dann einfach die andere Form mit dazu denken. Das sei nun mal so, wir sollen damit leben. Und in mir, die ich da in der 5. Reihe hinter meinem Laptop sitze, wächst ein Gefühl von Unbehagen in der Brust.
Eine weitere Professorin gendert selbstverständlich, spricht von Student*innen und Studierenden, baut in ihren Lehrplan ein Segment über Gender ein, als wäre es das Normalste auf der Welt.
Beide sind hochkompetente Professor*innen, beide Meister*innen ihres Fachs, beide haben einen unglaublichen Wissensschatz und vermitteln ihn auch professionell und gut. Und beide spannen ein Spektrum auf, das sowohl an der Uni also auch im Rest Deutschlands zu existieren scheint.
Da ist die eine Seite, die sich bemüht inklusiv zu gendern, alle sowohl binären als auch nicht binären Geschlechter miteinzubeziehen, und die andere Seite, die das Ganze für lächerlich und überzogen hält.
Man solle sich halt immer gefälligst angesprochen fühlen.
„Aber so funktioniert das nicht!“ will ich dann schreien. Sprache formt unser Weltbild, sie formt, wie wir denken, wie wir uns ausdrücken, wie wir die Welt sehen. Und gerade das ist der Punkt, an dem es für mich sehr persönlich wird. Denn ich bewege mich im allzu oft unsichtbaren Raum. Im Dazwischen und Nichtbinären. Wenn Gendern ein Meer ist, mit einem Boot für Frauen und einem für Männer, dann schwimme ich im Wasser irgendwo dazwischen und im Nirgendwo.
Wenn Professor*innen im generischen Maskulinum sprechen, fühlen ich und viele andere sich nicht angesprochen. Doch auch wenn sie versuchen, das Problem durch die Nennung von maskuliner und femininer Form zu umgehen, dann fühlt sich zwar ein Großteil adressiert, doch eben auch immer noch nicht alle.
Tatsächlich bemerke ich auch bei Kommiliton*innen eine ähnliche Verteilung. Vom generischen Maskulinum bis zum selbstverständlichen geschlechtsneutralen Sprachgebrauch ist alles dabei. Aber eines ist mir aufgefallen, jetzt, da nach anderthalb Jahren voller gekachelter Zoom-Vorlesungen wieder (teilweise) Präsenz ist: Der Anteil derjenigen, die gendergerechte Sprache wie selbstverständlich benutzen, ist gestiegen. Und irgendwie sollte mich das auch nicht verwundern.
Gendergerechte Sprache im Deutschen ist hochaktuell, viel diskutiert, teils verrissen und umstritten. Da wird dann von „Verunstaltung der deutschen Sprache“ gesprochen, es wird geschimpft, die Bedeutung von gendergerechter Sprache trivialisiert und Diskriminierung durch generische Maskulina geleugnet. Ein Schlachtfeld.
Gendergerechte Sprache ist wichtig.
Dabei ist der positive Effekt von gendergerechter Sprache belegt. In mehreren Studien. Da fällt mir eine 2011 von Stahlberg & Sczesny durchgeführte Studie ein, in der verschiedene Formen des Genderns auf ihre Inklusivität erforscht wurden. Hierbei kam heraus, dass bei Verwendung des generischen Maskulinums bei der Frage nach berühmten Persönlichkeiten deutlich mehr Männer als Personen anderen Geschlechts genannt wurden, als bei dem Stellen derselben Frage mit anderen und geschlechtsneutralen Formulierungen.
Und trotz dieser und weiterer Studien wird der positive Einfluss geleugnet, oder zumindest als nicht wichtig genug angesehen, dass man dafür die eigene Sprache ändern müsse. Denn eines muss ich zugestehen: Die eigene Sprache genderneutral werden zu lassen braucht gerade anfangs einen bewussten Aufwand. Es braucht Selbstkorrektur und ein gewisses Maß an Willen, die Welt aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Es ist zu Beginn unbequem, ungewohnt und neu.
Das Unsichtbare sichtbar machen.
Doch etwas, das so mancher Person, die sich der genderinklusiven Sprache verweigert, nicht bewusst ist, ist dies:
Wenn ihr nicht zumindest versucht, genderneutral zu formulieren, werdet ihr immer einen Teil der Welt nicht ansprechen und auch einen Teil der Welt nie zu sehen bekommen. Denn meine Welt, so freischwimmend in dem Ozean, den wir Gender nennen, ist bunt und vielfältig, hat alle Formen und Farben, die man sich nur vorstellen kann. Und auch ich als Student*in würde mich freuen, wenn eine Person sich die Zeit nimmt, mich in ihrer Sprache mit einzuschließen. Und wenn ihr sprecht, wollt ihr dann nicht zu allen Menschen sprechen?
Also probiert es zumindest einmal aus. An der Uni Neues zu lernen ist doch gerade der Grund, warum wir alle hier sind. Oder?
Unter #QueerOnCampus schreiben Studierende des Queer-Referat der Studierendenvertretung der LMU über  LGBTQ+ und andere Themen, die queere Personen im Zusammenhang mit München und dem Studium betreffen. Für die Inhalte sind allein die jeweiligen Autor*innen verantwortlich. Alle Beiträge der Serie hier nachlesen.
LGBTQ+ und andere Themen, die queere Personen im Zusammenhang mit München und dem Studium betreffen. Für die Inhalte sind allein die jeweiligen Autor*innen verantwortlich. Alle Beiträge der Serie hier nachlesen.



