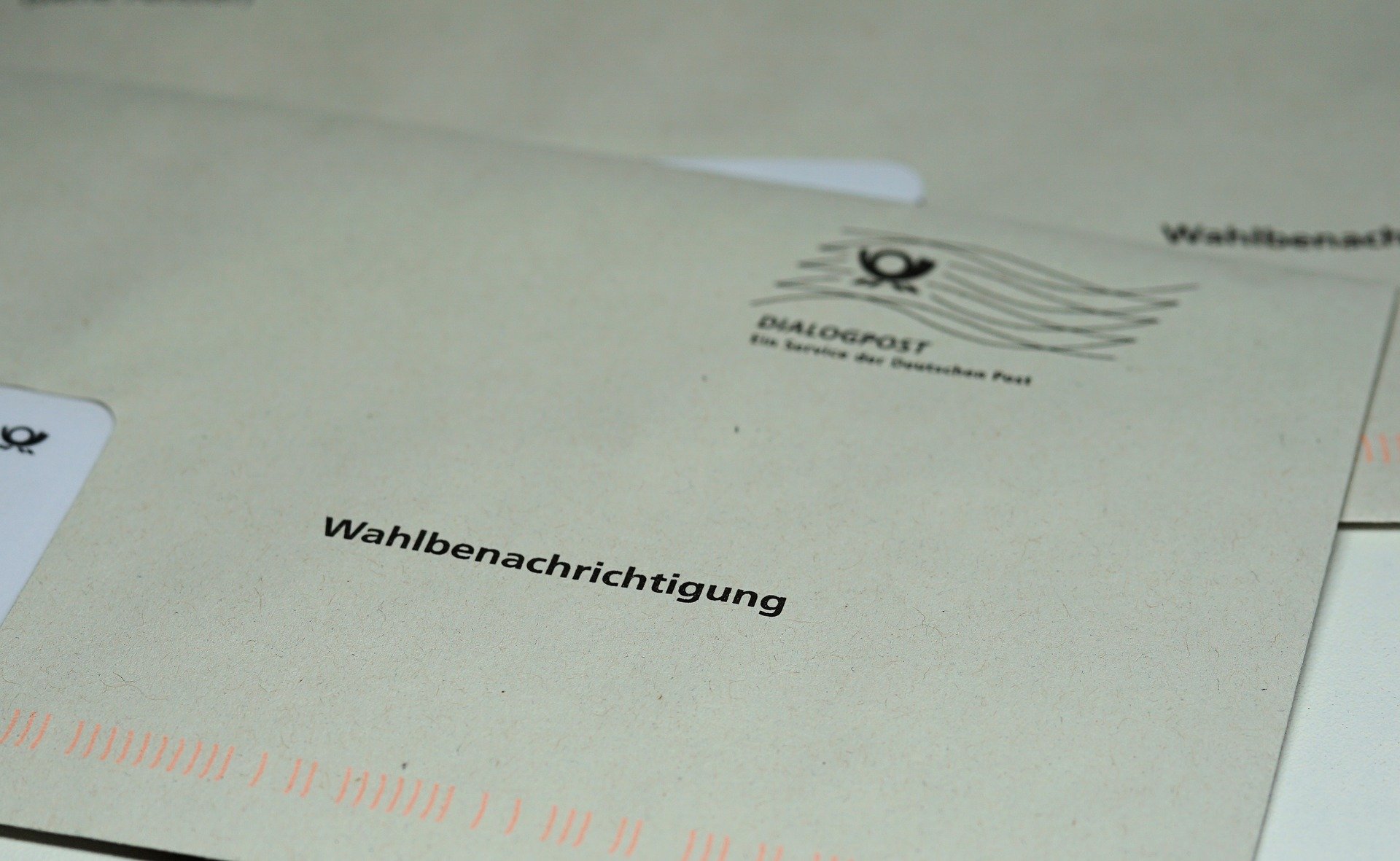Das Bayerische Hochschulinnovationsgesetz sorgt immer wieder für Aufruhr. Erst im November letzten Jahres wurden mehr als 9000 Protestunterschriften am Rande der Plenarsitzung des Bayerischen Landtags an den damaligen Wissenschaftsminister Bernd Sibler übergeben. Doch worin genau bestehen die Differenzen? Welche Chancen und welche Gefahren verbergen sich hinter dem Gesetz?

Von Patrycja Szarko-Popp
Erste Überlegungen zur Überarbeitung des Hochschulgesetzes entstanden schon im Jahr 2018 und beinhalteten insbesondere praktische Veränderungen, z.B. hinsichtlich der Tenure-Track-Professuren. Mit der Verkündung der Hightech Agenda Bayern im Sommer 2019 entstanden größere Reformpläne: Das neue Gesetz sollte einen wichtigen Baustein der Agenda bilden. „Die letzte große Gesetzesreform gab es 2006“, heißt es von Bernd Sibler, der bis zum letzten Mittwoch Wissenschaftsminister in Bayern war. „Nach 15 Jahren war es einfach Zeit, die aktuellen Herausforderungen abzubilden.“ Relevanter seien dabei vor allem die Themen der Nachhaltigkeit und der Digitalisierung geworden, darüber hinaus gelte es, neueren Entwicklungen im Bereich des wissenschaftlichen Nachwuchses und der Organisation der Hochschulen gerecht zu werden.
Der erste Entwurf
Im Herbst 2020 wurden schließlich die sogenannten Eckpunkte aufgestellt, die großes Aufsehen erregt haben. Vor allem der starke Fokus auf den Begriff des „Transfers“, also der Übertragung wissenschaftlicher Erkenntnisse in Wirtschaft und Gesellschaft, wurde vielfach kritisiert. Bemängelt wurden aber auch die Möglichkeit der Abschaffung von Fakultäten sowie die Stärkung der großen und damit eine Schwächung der kleinen Fächer.
Diese Kritik beruhte laut dem Minister a.D. teilweise auf einem Missverständnis. „Es war nie die Rede davon, dass nur noch die wissenschaftlichen Erkenntnisse zählen, die in die Anwendung gebracht werden können. Als studierter Historiker ist mir der Wert der Geistes- und Sozialwissenschaften für unsere Gesellschaft völlig klar. Ihre Leistungen zum Beispiel für den gesellschaftlichen Diskurs, für die Lehrerbildung oder auch für die Begleitung von Transformationsprozessen ist auch ein Transfer in die Gesellschaft hinein.“ Diese Missdeutungen seien jedoch durch ausführliche Verbändeanhörungen ausgeräumt worden und die Diskussionspunkte in den derzeitigen Gesetzesentwurf mit eingeflossen. Dessen besondere Stärke ist aus der Sicht von Bernd Sibler die Talent- und Karriereförderung. „Vom wissenschaftlichen Nachwuchs bis zur Spitzenwissenschaftlerin: Wir haben viele Elemente neu verankert, die ihrer Entwicklung zugutekommen und seit Langem gewünscht wurden. Die Hochschulen werden zur Einrichtung von Karrierezentren verpflichtet. Es gibt neue Wege zur Professur, an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften wird die Nachwuchsprofessur eingerichtet.“
Das Problem der Trias

Die Stimmen der Kritik verstummen dennoch nicht. Viele sind auch von der aktuellen Fassung enttäuscht und sehen in dem Gesetzesentwurf eine Bedrohung für die Wissenschaft.
Laut Dr. Eduard Meusel von der Initiative Geistes- und Sozialwissenschaften besteht die größte Gefahr des Gesetzes aus einer Trias aus der geplanten Einführung des Globalbudgets, der übermäßigen Stärkung des Präsidiums und einer fehlenden Fachaufsicht. Durch das Globalbudget könnten die Hochschulen das Geld selbst verteilen und wären gleichzeitig bei der Finanzierung von Fächern nicht mehr an Vorgaben aus dem Ministerium gebunden. Bei einer unzureichenden Finanzierung bedeute dies aber die Notwendigkeit einer Drittmittelforschung, was wiederum für enormen Verwertungsdruck der einzelnen Wissenschaften sorge und die kleinen Fächer benachteilige, deren Fokus nicht auf der Produktion von unmittelbar verwertbaren Ergebnissen liege. Darüber hinaus sollen die Machtbefugnisse des Präsidiums sowie des Hochschulrats gestärkt werden. Diese entscheiden zukünftig über Berufungen sowie über den Erhalt und die Schließung von Studienrichtungen. Eduard Meusel sagt dazu: „Das halte ich für sehr gefährlich. Ein Präsident, der eine Hochschule wie ein Unternehmen führt, muss auch die Rendite im Auge behalten. Das kann dazu führen, dass er sich vielleicht für einen Studiengang entscheidet, der mehr Drittmittel bekommen kann als ein anderer Fachbereich.“ Das Argument, die Geistes- und Sozialwissenschaften wären für die Begleitung des technologischen Fortschritts wichtig, sei an dieser Stelle unzureichend, denn ohne finanzielle Freiheit könnten diese gar nicht erst überleben. Vor allem in diesen Fächern müsse es möglich sein, sich in ein Thema zu vertiefen, es zu durchdringen, aber auch mal zu scheitern: „Das funktioniert in dem neuen System nicht mehr“, befürchtet Dr. Meusel. Zu welch radikalen Schritten Budgetkürzungen führen können, konnte man letztes Jahr beispielsweise in der Universität in Halle-Wittenberg beobachten. Dort hatte der Präsident aufgrund eines starken budgetären Drucks entschieden, die Altertumswissenschaften abzuschaffen. Die Entscheidung konnte letztlich durch einen Senatsbeschluss verhindert werden, allerdings ist fraglich, ob dies mit der zukünftigen Machtfülle des Präsidenten auch noch möglich sein könnte.
Die Promotionszeit
Auch der akademische Mittelbau ist dem aktuellen Entwurf gegenüber skeptisch, denn dieser sei „jeder Realitätsnähe entbehrt“, wie in einem Statement des wissenschaftlichen Mittelbaus der Fakultät 9 der LMU München zu lesen ist. Ein Beispiel dafür ist die Promotionsphase, die nicht die durchschnittliche Promotionsdauer in den Geistes- und Kunstwissenschaften von sechs bis sieben Jahren berücksichtigt. Diese Kritik weist Wissenschaftsminister a. D. Sibler jedoch entschieden zurück: „Niemand wird grundsätzlich durch die bestehenden oder auch durch geplante gesetzliche Regelungen davon abgehalten, die Promotion abzuschließen.“ Das Gesetz beinhalte lediglich Zielvorgaben bezüglich der Immatrikulationsdauer während einer Promotion. Diese soll vier Jahre betragen – somit ein Jahr länger als derzeit. „Ich denke, das ist eine gute Regelung“, sagt ehemalige Minister Sibler. „Ungeachtet dessen halte ich es aber auch für wichtig, dass wir im Interesse der Doktorandinnen und Doktoranden auf Gesetzesebene deutlich machen, dass die Qualifikation zielgerichtet erfolgen sollte. Ein Promotionsvorhaben, das länger als vier Jahre in Anspruch nimmt, sollte daher die Ausnahme sein.“
Diese Regelung ist aus der Sicht der Gesetzeskritiker jedoch unbefriedigend. Sie entziehe den Wissenschaftler*innen den Freiraum, den sie gerade für die Promotion brauchen, argumentiert Dr. Meusel. Vor allem bei den Geisteswissenschaften sei die Promotion enorm zeitaufwendig. Das hänge beispielsweise mit der Archivarbeit zusammen, die allein schon zwei Jahre dauern kann. Nicht zu vernachlässigen sei ferner, dass die meisten Doktoranden nebenbei arbeiten müssten. „Eine ernsthafte geisteswissenschaftliche Promotion, die neue Gebiete erforschen will, ist nicht in zwei, drei Jahren gemacht.“
Die unbefristeten Stellen
Die Einwände des Mittelbaus beziehen sich ferner auf die unzureichende Anzahl an unbefristeten Stellen: Eine Problematik, die durch die Twitter-Kampagne #ichbinhanna letztes Jahr große Wellen geschlagen hat. Dabei könnte einer der Lösungsansätze für mehr unbefristete Stellen darin bestehen, allgemein mehr Stellen zu schaffen. Das ist auch für den Minister a.D. Sibler ein großes Anliegen. Er sieht in dem Gesetzesentwurf in dieser Hinsicht große Verbesserungen: „1240 Stellen, die bislang befristet waren, können wir nun zu dauerhaften machen. Und: Wir schaffen rund 2500 Stellen neu. Mit insgesamt knapp 3800 unbefristeten Stellen schaffen wir eine sehr gute Perspektive für den akademischen Nachwuchs. Das ist meines Wissens das größte Programm dieser Art in ganz Europa.“
Dies ist laut Dr. Meusel jedoch nicht genug – zumindest nicht für die Geistes- und Sozialwissenschaften. Die entfristeten Stellen würden vorwiegend im Bereich der Hochtechnologie- oder MINT-Wissenschaften geschaffen werden und es handle sich dabei zu einem Großteil um Professuren. Darüber hinaus werden 1240 Stellen nicht neu geschaffen, sondern nur entfristet. Dabei stellt die Entfristung keinen neuen Vorgang dar. Solche gab es auch bereits in der Vergangenheit, wenn auch ihre Zahl in den letzten zwei Jahrzehnten merklich abgenommen hat. Auch die Anzahl der Stellen lasse zu wünschen übrig: Insgesamt sind in Bayern ca. 105.000 Personen an den Hochschulen beschäftigt, knapp 60.000 davon mit wissenschaftlicher oder künstlerischer Tätigkeit. Die Entfristungen treffen also nur etwas mehr als 1% der Beschäftigten an den Hochschulen oder eben knapp 2% der wissenschaftlich Beschäftigten. „Das löst nicht das strukturelle Problem im Mittelbau, wo nach wie vor mehr als 90% der Beschäftigten befristet angestellt sind.“
Der Gesetzentwurf scheint also trotz zahlreicher Dialoge nicht alle Interessensgruppen zufriedengestellt zu haben. Die Proteststimmen sind nach wie vor sehr laut. Es bleibt abzuwarten, wie das endgültige Ergebnis ausfällt. „Wir sind dabei hier auf der Zielgeraden“ hieß vor einigen Wochen noch vom damaligen Wissenschaftsminister Sibler.