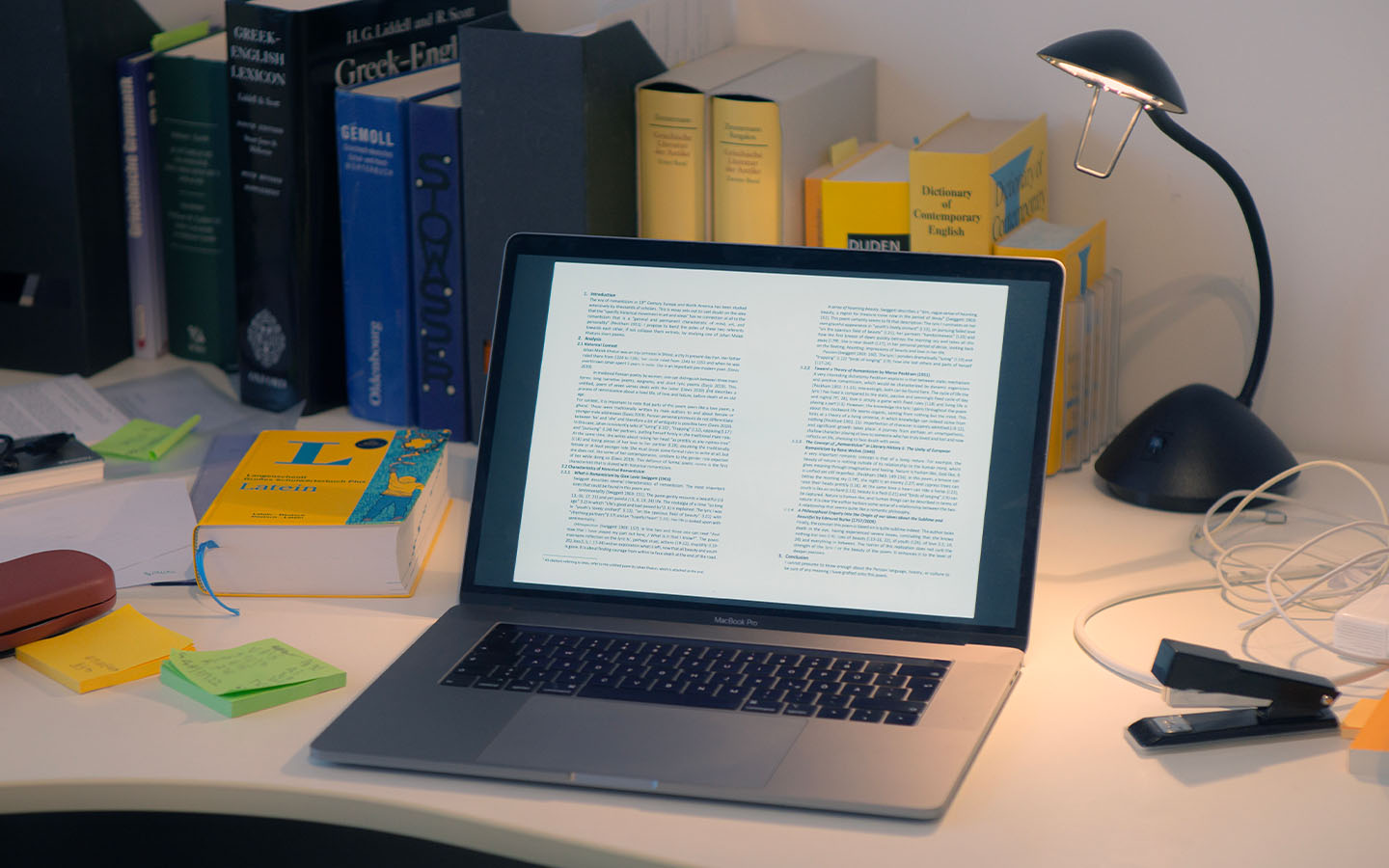Ein Hörsaal: Auf den Bänken sitzen überwiegend Frauen und am Pult wechseln sich Männer ab. In Bayern ist der Anteil an Frauen unter den Lehrstühlen erschreckend gering. Wie kann das sein?

Von Max Fluder
Regentropfen rinnen wie Tränen die Scheibe herunter. Der erste Herbststurm zieht über München hinweg. Hier in ihrem Büro sitzt sie, die Einzelkämpferin. Zumindest nennt sie sich selbst so. Margit Weber führt ihren Kampf jedoch nicht nur aus der Schellingstraße 10 heraus und auch nicht nur für sich. Als Frauenbeauftragte der LMU vertritt sie rund 60 Prozent der Studierenden und mehr als die Hälfte der Promovierenden. Als Landesfrauenbeauftragte ist sie auch in Berlin aktiv – stellvertretend für die bayerischen Hochschulen. Der Koffer und die Reiselektüre stehen noch im Eingangsbereich. Gestern ist sie wiedergekommen.
Bayern ist Schlusslicht in Deutschland, was den Frauenanteil unter den Professuren anbelangt. Knapp 19 Prozent sind es; die LMU hat drei Prozentpunkte mehr als im Landesdurchschnitt. Während bei den wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen noch ein relativ ausgeglichenes Verhältnis vorliegt, sucht man auf den oberen Ebenen teils vergeblich nach Frauen. Nur die Sprach- und Kulturwissenschaften werden von Frauen geleitet. Zwei von 18 Fakultäten.
Uni – von Männern für Männer
Universitäten sind in alten Gebäuden untergebracht. Noch alteingesessener ist die männliche Dominanz in Lehre und Religion. Margit Weber (*) sieht darin eine der Ursachen für das Missverhältnis. Bildungseinrichtungen seien von Männern für Männer gebaut worden und diesen Anspruch erfüllen sie heute noch. Das Frauenwahlrecht wurde vor 100 Jahren eingeführt, im gleichen Jahr promovierte die erste Frau Deutschlands. Und das an der LMU! Vor dem Gesetz sind die Geschlechter gleich. Im Denken und Handeln hat sich diese Erkenntnis noch nicht durchgesetzt.
Ist eine wissenschaftliche Stelle frei, wird sich meist für Mitarbeiter*innen des Instituts entschieden. Hier schleicht sich häufig unconscious bias, die unbewusste Voreingenommenheit, in den Entscheidungsprozess ein. Männer und Frauen suchen nach solchen Anwärter*innen, die ihnen selbst ähneln und denen sie entsprechende Aufgaben zutrauen. In der Realität bedeutet das oftmals: Männer berufen Männer. Evelyn Schulz, stellvertretende Frauenbeauftragte der Kulturwissenschaften, bringt es auf den Punkt: „Es geht nicht weiter.“ Gemeint ist damit, dass es sehr schwierig ist, eine Anschlussstelle mit längerfristiger Perspektive zu finden. „Mittelbaustellen“ – geeignet für eine Weiterqualifikation – sind eher weniger geworden. Hinzu kommt, dass Erstberufungen in der Regel auf niedrige Besoldungsstufen ausgeschrieben werden und damit schlechter ausgestattet sind als etablierte Amtsinhaber*innen. Der wissenschaftliche Betrieb wird auf kurzfristige Erfolge getrimmt. Das „Beharrungsvermögen“ der Männer und die drohende Unvereinbarkeit mit der Familienplanung, die aufgrund der gesellschaftlichen Prägung immer noch den Frauen zugeschrieben wird, hindern junge Wissenschaftlerinnen daran, Karrieren an Universitäten zu verfolgen.
Die geringe Zahl an Professorinnen hat über die Lehrstühle hinaus Folgen. Besonders Studentinnen finden weniger Ansprechpersonen für gender-sensible Themen in akademischen Arbeiten. Das ungleiche Verhältnis zwischen den Geschlechtern wirkt jedoch auch außerhalb des Hörsaals. In manchen Situationen werden gezielt Zuhörerinnen gesucht. Ein Extremfall: „Was mache ich, wenn jemand mit mir im Seminar sitzt, der mich belästigt hat?“
Forschung ohne Perspektivwechsel
Professoren können bestärkend auf junge Frauen wirken und die patriarchalen Machtmechanismen können auch von Frauen missbraucht werden, welche bereits hohe Positionen innehaben. Am System ändert das Verhalten einzelner aber nichts. Es fehle an „Erreichbarkeit“. So nennt die Soziologin Manuela Sauer die Tatsache, dass es nur wenige weibliche Vorbilder gibt. Wo bleibt das „Ich kann es auch schaffen“? Selbst wenn der Lehrstuhl erreicht ist, kommen Vorurteile auf. Eine Professorin der Anglistik verschweigt ihren Beruf vor Dritten, wenn sie mit ihren Kindern unterwegs ist. „Rabenmutter“ sei einer der Vorwürfe aus ihrem Freundeskreis gewesen.
Große Teile der Bevölkerung werden strukturell von den hohen Positionen der Unis ferngehalten. Nicht nur Frauen. Auch ethnische Minderheiten oder Menschen mit Behinderung sind unterrepräsentiert. Margit Weber hütet sich vor Aussagen wie „Frauen machen es besser“. Es gehe um „Blickwinkel und Vielfalt“. Darum also, wovon die Forschung lebt.
Anfeindungen erreichen das Büro der Frauenbeauftragten trotzdem. Für Weber ist es die Angst, die dort spricht. Dabei seien viele der Männer ebenfalls nur in ihren Rollen gefangen. Die Zukunft gestalten sie damit nicht – das ermöglichen andere Maßnahmen. Sie verweist auf ein Mentoring-Programm, das aus einem kleinen Satz der ersten Exzellenzinitiative gewachsen ist. 600 Frauen fanden Netzwerke und Motivation; 500 von ihnen sind heute Professorinnen. Mit dem Ende der Initiative fielen allerdings auch die Fördermittel für das Mentoring weg.
Nach Ansicht von Evelyn Schulz braucht es mehr als nur Programme. Wenn Geld für die Einbindung von Frauen in den akademischen Betrieb bereitgestellt wird, kann sich etwas ändern. Langfristige Perspektiven; keine kurzzeitigen Befristungen und Boni. So werden Arbeit und Leben, Forschung und Familie miteinander vereinbar.
In einem Innovationsbündnis hat das Bayerische Wissenschaftsministerium sich zur Erhöhung des Frauenanteils verpflichtet – mit angedrohten Sanktionen. Doch diese stehen laut Weber auf der Kippe. Dabei sei Geld einer der wenigen funktionierenden Faktoren. Ihre Kritik hat sie bei Marion Kiechle, der vorherigen Ministerin für Wissenschaft, bereits kundgetan. Mit einem leichten Lächeln schaut die Kämpferin in die Zukunft: „Weniger wird’s nicht. Dass es so bleibt, wie es ist, wäre das Schlimmste.“
(*) Korrekturanmerkung der Redaktion: In der Printversion dieses Artikels, der zuerst in unserer 27. Ausgabe erschienen ist, stand an dieser Stelle ein anderer Vorname; außerdem wurde Margit Weber fälschlicherweise als Lehrstuhlinhaberin der Theologie bezeichnet. Diesen Fehler haben wir hier korrigiert und entschuldigen uns aufrichtig dafür.