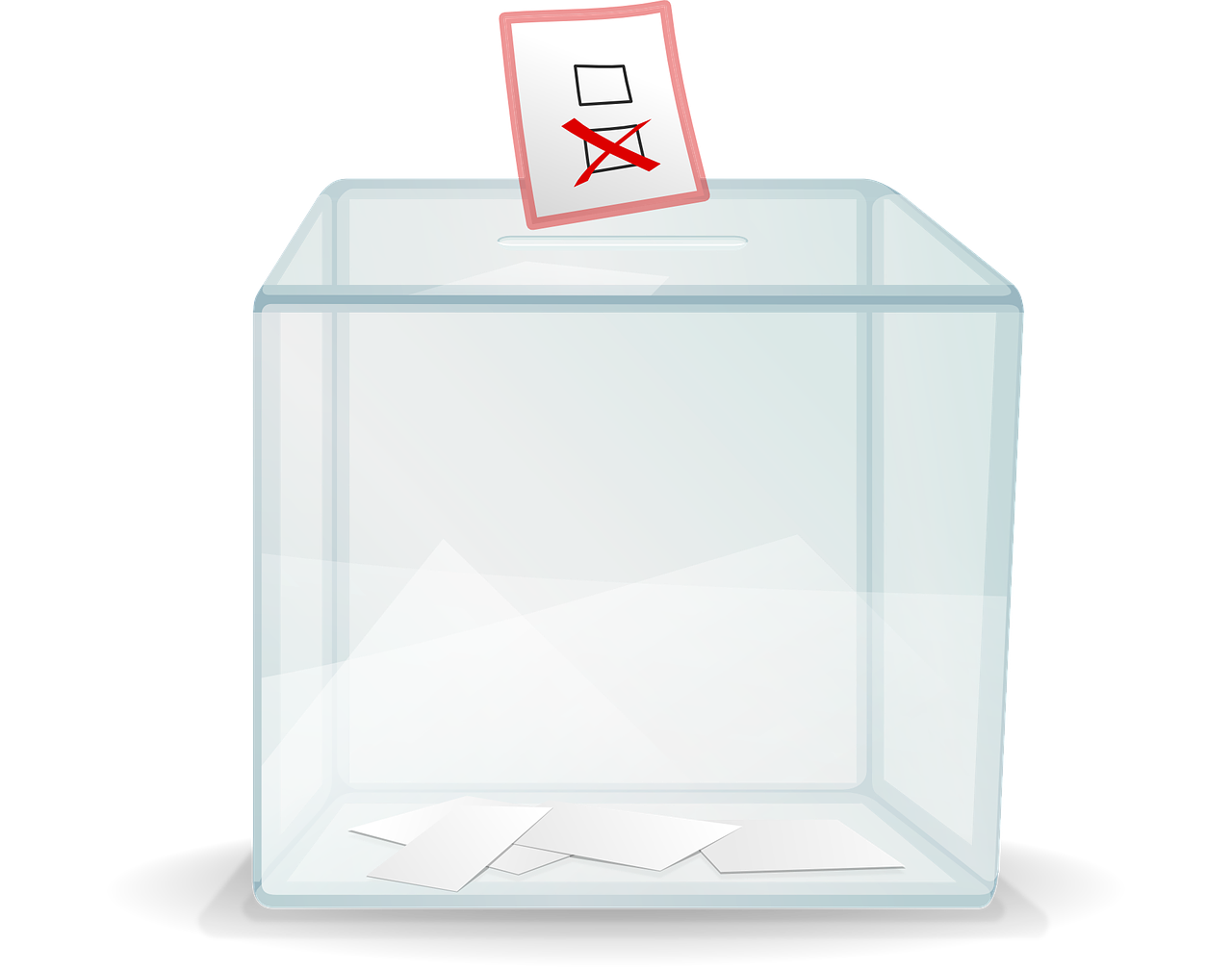Foto: Matthew Rutledge
Der kolumbianische Konflikt im Spiegel persönlicher Erfahrungen
Marias Ehemann wurde vor 15 Jahren ermordet. Sie weiß bis heute nicht, ob von Paramilitärs oder einer linksgerichteten Guerillagruppe wie der FARC. Es könnten auch gewöhnliche Drogenbanden die Schuld an dem Tod ihres Mannes tragen. Letztendlich will sie aber auch nicht ausschließen, dass es vielleicht Soldaten der offiziellen kolumbianischen Streitkräfte waren, die den entscheidenden Schuss abgaben. Diese Austauschbarkeit einer Vielzahl von Akteuren ist bezeichnend für den Konflikt, der Kolumbien seit nunmehr fast 50 Jahren in Atem hält. Nachdem die Konservativen und Liberalen ihre Streitigkeiten in einem von 1958 bis 1974 währenden Abkommen beigelegt hatten, demgemäß sie stets abwechselnd den Präsidenten stellten und andere Parteien verboten wurden, kam es zu einer Radikalisierung linksgerichteter Splittergruppen. Eines ihrer Kernanliegen war eine Landreform, die angesichts der unglaublichen sozialen Ungleichheit, die auch jetzt noch die Gesellschaft Kolumbiens prägt, notwendig erschien. Nach dem Versuch des kolumbianischen Staates, diese Bewegung gewaltsam zu unterdrücken, bewaffneten sich die marxistischen Gruppen und wurden zur Guerilla. Die bekannteste unter ihnen sind die Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Zu nennen sind aber ebenso das Ejército de Liberación National (ELN) oder die bereits aufgelöste M 19-Stadtguerilla.
Heute jedenfalls sei Kolumbien viel sicherer, sagt Maria. Dank Ex-Präsident Álvaro Uribe. Zwischen 2002 und 2008 fuhr der Hardliner Uribe einen kompromisslosen Kurs gegen die FARC, die früher seinen Vater ermordet hatten. Mit finanzieller Unterstützung durch die USA, die im Rahmen des sog. Plan Colombia große Summen in die Aufrüstung der kolumbianischen Streitkräfte investierten, konnte er die Guerilla in fast allen Landesteilen zurückdrängen. Gerade das Reisen auf dem Landwege wurde durch die starke Militärpräsenz deutlich erleichtert. 90 Prozent aller Kolumbianer befürworteten dieses Vorgehen.
Davon unbeeindruckt zeigte sich hingegen das kolumbianische Verfassungsgericht, das ein Referendum, welches Uribe eine dritte Amtszeit erlaubt hätte, für verfassungswidrig erklärte, sodass er seinen Platz für den vorherigen Verteidigungsminister Juan Manuel Santos räumen musste. Auch die Vereinten Nationen sehen in Uribe keinen Helden. Vielmehr hat er laut einem ausführlichen Bericht aus dem Jahre 2010 Menschenrechtsverletzungen zu verantworten. Es geht um die sogenannten falsos positivos. Um die Erfolgszahlen im Kampf gegen die Guerilla zu erhöhen, wurden teilweise unschuldige Männer getötet, um sie dann als besiegte Guerillakämpfer zu deklarieren. Maria mag dies nur zum Teil glauben. Zu hell strahlen die Erfolge Uribes für sie, als dass diese in ihren Augen von derartigen Vorfällen überschattet werden könnten.
Uribe hat sich auch des Problems der rechtsgerichteten Paramilitärs angenommen, die in ihrem privaten Kampf gegen die Guerilla das staatliche Gewaltmonopol ebenfalls unterwandern. Allerdings bevorzugte Uribe hier ein anderes Vorgehen. Den Kämpfern der Autodenfensas Unidas de Colombia (AUC), einem Zusammenschluss paramilitärischer Verbände, sicherte er milde Urteile zu, um sie für ihre Selbstentwaffnung zu belohnen. Diese weitgehende Strafffreiheit wird durchaus kontrovers diskutiert. In der Tat halten viele dieses Vorgehen für einen Skandal und denken dabei daran, wie skrupellos diese rechtsgerichteten, in den Drogenhandel involvierten Gruppen gegen mit der Guerilla sympathisierende Bauern vorgingen oder von Großgrundbesitzern angeheuert wurden, um deren Interessen blutig durchzusetzen.

Foto: Philip Bender
Kolumbiens Tourismus leidet unter dem Konflikt
José, ein Touristenführer zur Ciudad Perdida, der verlorengegangenen Indianerstadt mitten im Dschungel, die erst in den 1970er Jahren wiederentdeckt wurde und nach einem Gemetzel unter den Grabräubern für den Tourismus geöffnet wurde, legt Wert auf eine differenzierte Betrachtung. Nicht alle Paramilitärs könnten über einen Kamm geschert werden. Bis zum Jahre 2006, als ein Gebirgsjägerbataillon des Heeres die Sicherung der archäologischen Stätte übernahm, habe eine lokale, paramilitärische Bürgerwehr für Sicherheit gesorgt. Gräueltaten habe diese Gruppe nicht verübt. Irgendwer müsse sie ja gegen die Guerilla schützen. Sein Kollege Andrés stimmt zu. Als die Guerilla früher in seiner Heimatgegend noch stark gewesen sei, habe sie ihn zwangsrekrutieren wollen. Von seiner Oma sei er in ihrem Bohnenlager versteckt worden, um dann aus dem Gebiet zu fliehen und hierherzukommen – tatsächlich ist Kolumbien nach dem Sudan das Land mit den meisten Binnenflüchtlingen. Der Nebenbuhler um seine damalige Freundin habe übrigens weniger Glück gehabt. Dieser habe sich mit der Guerilla offen angelegt und sei von ihr erschossen worden. Wenigstens einmal sei sie nützlich gewesen. Andrés lacht trocken.
Doch der ehemalige Präsident hat nicht nur Befürworter. Der Literaturstudent Pablo aus Bogotá zum Beispiel hält nichts von Uribe. Die Entwaffnung der Paramilitärs sei letztendlich nur ein Scheinerfolg, hätten sich doch viele Gruppen neu organisiert und trieben nach wie vor als kriminelle Banden ihr Unwesen. Viele würden sich ganz pragmatisch nunmehr vollends auf den Drogenhandel konzentrieren, der schon lange die Haupteinnahmequelle aller nichtstaatlichen Akteure des Konflikts ist. Andere gingen aber durchaus auch noch gegen politische Gegner vor. Wie sonst seien die Morde an den Gewerkschaftsführern im Jahr 2008 zu erklären? Und ganz abgesehen von den falsos positivos – wie könne man denn den Konflikt mit der Guerilla militärisch lösen? Selbst wenn es möglich wäre, die FARC im Krieg zu schlagen – was angesichts der geographischen Struktur des Landes, geprägt von Regenwald und zerklüftetem Bergland, durchaus bezweifelt werden darf – sei dies nicht der richtige Weg. Tausende müssten noch sterben. Tausende, von denen eine große Zahl zwangsrekrutiert wurde. Und wie tragfähig wäre ein Friede, der so errungen wurde? Natürlich sei Kolumbien jetzt sicherer als vor Uribes Amtsantritt, aber das Militär an jeder Straßenecke sei doch wohl nicht zu übersehen. Würde es abgezogen, wären Unsicherheit und Gewalt zurück. Hinter dem bewaffneten Konflikt stehe ein sozialer Konflikt, den es zu lösen gelte. Erst dann sei an einen dauerhaften Frieden zu denken. Allerdings hätten auch die FARC kontinuierlich an Rückhalt in der Bevölkerung verloren.

Foto: Philip Bender
In der Tat ist mit dem Ende des Paktes zwischen Liberalen und Konservativen seit 1974 grundsätzlich die Interessenvertretung im offiziellen politischen Diskurs möglich. Die moralische Integrität, die die Rebellen gerne als Kontrast zur korrupten Regierung entwarfen, ist seit ihrer immer stärkeren Verstrickungen in den Drogenhandel nicht mehr als eine Farce. Auch Entführungen können keine Beliebtheitspunkte in einem Land bringen, das angesichts seines Reichtums an auch aufgrund des Konflikts weitgehend unberührter Natur und zahlreicher historischer Zeugnisse aus präkolumbianischer sowie kolonialer Zeit mehr und mehr auf den Tourismus setzt.
Eine politische Integration der Rebellen scheint möglich
Der Geschichtsdoktorand Daniél aus Popayán kann da nur zustimmen. Sein Bruder sei beim Militär und regelmäßig an Scharmützeln beteiligt. Wenn man in einer Stadt wie Bogotá wohne, in der der Konflikt seit jeher weit weg erscheine, und wenn man das Geld habe, dafür zu zahlen nicht eingezogen zu werden, dann sei es natürlich leicht, eine militärische Lösung zu befürworten. Aber letztendlich stehe und falle der Konflikt mit der sozialen Frage der Agrarreform. Deshalb sei der Weg Santos‘, mit den FARC zu verhandeln, grundsätzlich zu begrüßen. Derartige Verhandlungen könnten aber nur dann gelingen, wenn der Staat es schaffe, den Rebellen glaubhaft zu versichern, dass er ihre politische Repräsentanz hinreichend gegen rechtsgerichtete Auftragsmorde ehemaliger paramilitärischer Gruppierungen zu schützen vermöge. Allzu oft habe es traumatisierende Massaker unter linken Präsidentschaftskandidaten gegeben. Beispiele für eine gelungene Integration ehemaliger Guerilla-Kämpfer in den politischen Diskurs lassen sich indes auch finden: etwa Gustavo Petro Urrego, der derzeit amtierende Bürgermeister von Bogotá. Wie viele andere ehemalige Mitglieder der M 19-Stadtguerilla fand er die Möglichkeit, seine Interessen auf friedlichem Wege innerhalb der staatlichen Strukturen zu vertreten.

Foto: medea_material
Maria ist hinsichtlich der Friedensverhandlungen anderer Meinung. Warum werde denn in La Habana in Kuba verhandelt und nicht auf kolumbianischem Boden? Doch wohl nur, damit die FARC ihre im Niedergang befindliche Führung außer Landes bringen könne, um von dort in aller Sicherheit den Kampf weiter anzuführen. Andere Hardliner lehnen die Verhandlungen kategorisch mit dem Hinweis ab, dass es sich bei der FARC um Terroristen handle – und mit denen werde nicht verhandelt. Dies bedürfe keiner weiteren Begründung.
Die Verhandlungen in La Habana sind zäh. Ideologisch aufgeladene Rhetorik erschwert die Kompromissfindung, die nach dem Ende der 14. Verhandlungsrunde im September dieses Jahres noch weit entfernt erscheint. Dennoch sind die Friedensaussichten so gut wie noch nie. Die militärischen Erfolge gegen die FARC unter Uribe und Santos haben dazu geführt, dass der kolumbianische Staat als Verhandlungspartner ernst genommen wird. Die Rebellen haben nunmehr ein existentielles Interesse daran, den Konflikt beizulegen, um nicht noch weiteren schmerzlichen Verlusten ausgesetzt zu sein. Santos seinerseits, dessen Umfragewerte nicht gerade glänzend sind, könnte bis zur nächsten Präsidentschaftswahl im Mai 2014 einen Friedensvertrag als Wahlwerbung gut gebrauchen – und hat sich so auch zum Ziel gesetzt, noch in dieser Amtszeit ein entsprechendes Abkommen zu unterzeichnen. Tourismus und Wirtschaft im Land sind im Aufschwung begriffen, sodass der Konflikt ganz allgemein mehr und mehr als hinderlich empfunden wird.
Es bleibt das Problem der Agrarreform. Auch Kolumbianer, die in keiner Weise mit der Guerilla sympathisieren, sehen darin ein legitimes Anliegen. Unabhängig von den derzeit laufenden Friedensverhandlungen verlören die Rebellen ihren letzten Legitimationsstrang, wenn es gelänge, hier eine angemessene Lösung zu finden. Dann könnte dieses Kapitel trauriger Gewalt endgültig geschlossen werden. Alle Probleme Kolumbiens sind damit freilich noch nicht gelöst. Inwieweit beispielsweise der Drogenhandel mit der von Santos vorgeschlagenen Legalisierung einzudämmen wäre, bleibt abzuwarten. Die Wechselwirkung zwischen den einzelnen Konfliktherden ist jedenfalls nicht zu unterschätzen, sodass Erfolge in der einen in der Regel auch Erfolge in der anderen Sache mit sich bringen.