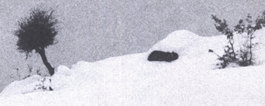Eine dunkle Bühne. Plötzlich ein schwarzes, schäumendes, wütend tosendes Meer, auf dem ein Schiff wie ein Spielzeug hin und her geworfen wird. Menschen versuchen, an das Ufer zu gelangen. Manche von ihnen werden von den Wogen verschluckt und verschwinden in ein noch tieferes Schwarz.
Szenisch bildgewaltig setzt „Die letzte Karawanserei“ unter der Regie von Jochen Schölch im Metropoltheater München ein. Das von Ariane Mnouchkine geschriebene und in Paris uraufgeführte Stück setzt sich aus über 400 Interviews mit Flüchtlingen und ihren Erzählungen zusammen. Ihre Geschichten wurden in Handlungsstränge verwoben und über den Abend in einer zweieinhalbstündigen Aufführung episodisch nacherzählt. So verschieden, wie man es sich nur vorstellen kann, sind die Geschichten: Von Gerichtsverhandlungen über Auspeitschungen bis hin zu Zwangsprostitution zeigt „Die letzte Karawanserei“ menschliche Abgründe. Nur selten ist ein Silberstreif und ein Hauch von Güte zu sehen – welche im nächsten Moment wieder von unbeschreiblicher Grausamkeit torpediert werden.

Die Bildgewalt der Inszenierung verleiht der Erzählung mit einfachen Mitteln eine große Eindringlichkeit, die das Bild der Verzweiflung noch deutlich verstärken: Hoffnungslosigkeit und karge Aussichten auf die Zukunft. Eine oft beinahe leere Bühne, die Requisiten spärlich, aber großes schauspielerisches Talent. Dann aber die faszinierende Nutzung eines großen durchscheinenden Vorhangs, welcher den Effekt einer eigenartig transparenten Grenzerfahrung erzeugt. Der Vorhang wird umfunktioniert in das tosende Meer oder die exorbitante Vergrößerung der Gesichter der Fragesteller bei einem Einwanderungsprozess in Australien. Manchmal tönt Gelächter aus den dicht besetzten Reihen der Zuschauer. Aber meist wird der Raum beherrscht von ungläubigem Schweigen oder scharfem Aufatmen. Eine Frau spielt nervös mit den Haaren. Dann wieder Stille. Menschenverachtende Gewalt auf der Bühne.

So wird man Zeuge, wie eine Mutter ihre 14-jährige Tochter in einem Auffanglager zur Prostituierten macht, wie die Tochter nach dem „Besuch“ eines ihrer Freier auf die Bühne rennt und sich übergibt; die Mutter sich neben sie kniet und ihr sagt: „Halte durch, nicht mehr lange. Wir gehen nach England. Wir brauchen nur noch das Geld.“
Später entpuppt sich vor den Augen des Publikums ein Schlepper als Menschenhändler. Zuerst schlägt er eine fliehende Frau, der er zuvor den Pass abgenommen hat, brutal zusammen. Doch Sekunden darauf singt er am Telefon ein Schlaflied vor – die zwei Gesichter, die er benutzt, um möglichst viel „Ware“ zu erhalten.
Dann: Ein Liebespaar. Der Mann und die Frau spaßen zusammen, er bringt sie zum Lachen. Ihr Gelächter ist wie Balsam für die zum Zerreißen gespannte Seele des Zuschauers. Doch das Ende ihrer Geschichte führt – wie auch die vielen anderen Geschichten – an die Grenze der emotionalen Belastbarkeit.

Dementsprechend schweigsam gibt sich das Publikum. Auch als die Pause beginnt, setzen Gespräche nur schleppend ein; das erste Wort: „Unglaublich.“ Und dann noch einmal: „Einfach… unglaublich.“Diese Ungläubigkeit zieht sich bis zum Schluss durch, der Zuschauer verlässt das Theater überflutet mit Eindrücken und flauem Gefühl im Magen.
Auf der Bühne ist nicht nur ein Theaterstück zu sehen, sondern es spielen sich wahre Geschichten und echte Erlebnisse vor dem Zuschauerauge ab – ein zum Stück gewordener Ausschnitt aus dem Leben echter Menschen. Wer hier zusieht, fühlt sich, als stünde er an Stelle der Schauspieler am Abgrund des menschlich Erträglichen – und ist sich bisweilen nicht sicher, ob man nicht schon einen Schritt weiter ist.