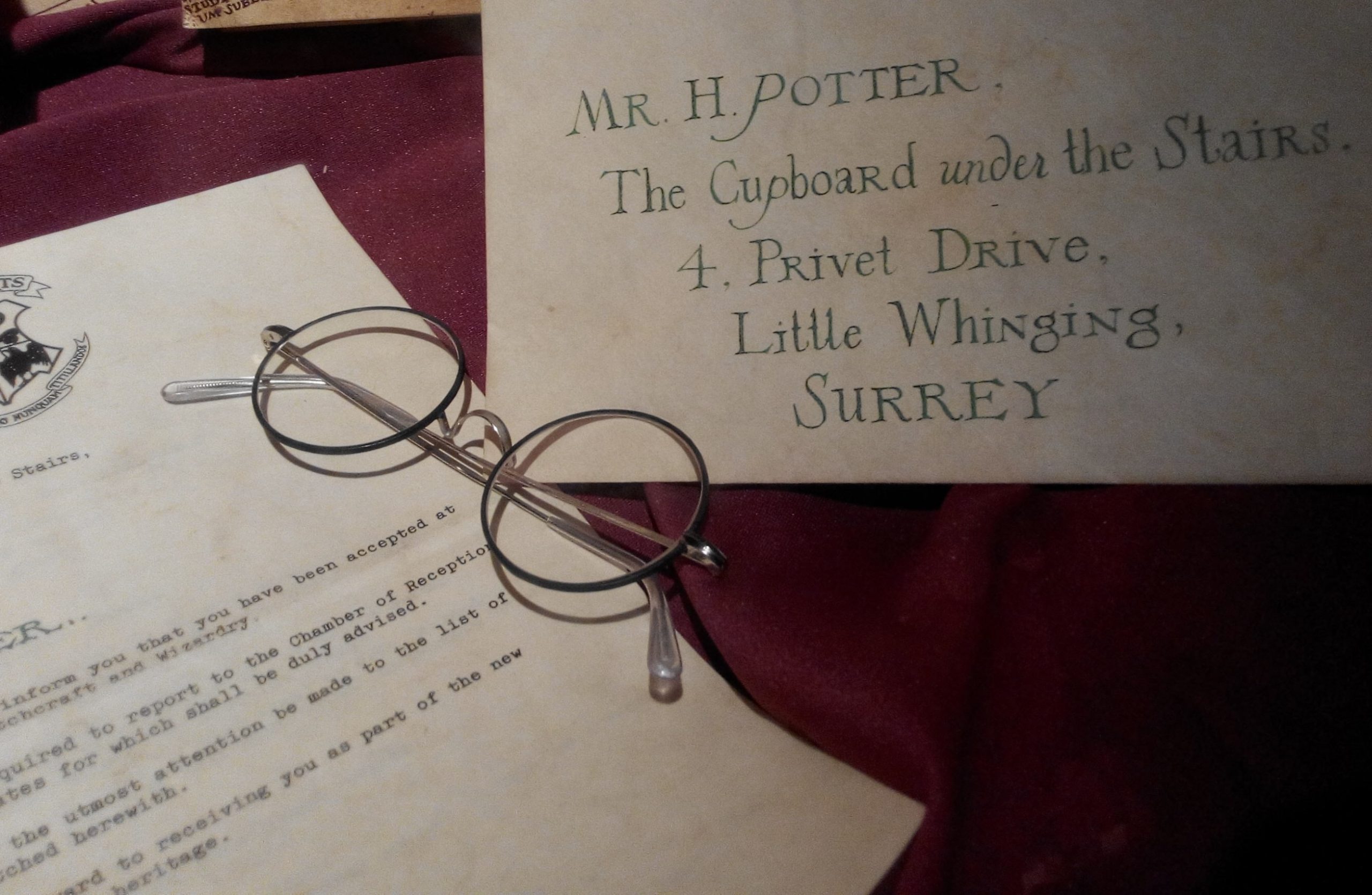Wie Stereotype noch immer Geschlechterdiskriminierung begünstigen
Frauenquote, Homo-Ehe, Betreuungsgeld: Das Thema Geschlecht und seine rechtlichen Rahmenbedingungen spielen in der Öffentlichkeit eine große Rolle. Für die neue Philtrat-Ausgabe trafen wir die Wiener Rechtsphilosophin Elisabeth Holzleithner im Herzen Wiens. Sie habilitierte sich im Jahr 2011 als erste Frau überhaupt im Fachbereich der Legal Gender Studies. Hier nun die ausführliche Version des Interviews über Geschlechtergerechtigkeit, Landeshauptfrauen und starre Rechtsstrukturen.
 Aus welchem Kontext heraus sind die Gender Studies überhaupt entstanden?
Aus welchem Kontext heraus sind die Gender Studies überhaupt entstanden?
Die Befassung mit der Geschlechterfrage tritt in der Geschichte immer wieder in Wellen auf. Dabei wechseln sich gleichheitsdogmatische und differenztheoretische Ansätze ab. Erstere sagen, Männer und Frauen seien gleich und man dürfe bei ihnen keine Unterschiede machen, während letztere der Meinung sind, dass die Gesellschaft daran krankt, dass Weiblichkeit unterdrückt wird und dass es Frauen im öffentlichen Leben braucht, um spezifisch weibliche Qualitäten einzubringen. Diese unterschiedlichen Zugänge zeigten sich schon beim Kampf um das Wahlrecht von Frauen, der das 19. Jahrhundert geprägt hat. Die zweite Welle der Frauenbewegung rollte dann nach dem zweiten Weltkrieg an. Ein ganz wichtiger Bezugspunkt ist bekanntlich Simone de Beauvoir mir ihrer Differenzierung von Sex und Gender: Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird zur Frau gemacht, so ihr berühmtester Satz. Und während in den 1970er und 1980er Jahren die Befassung mit Geschlecht vorwiegend unter dem Titel „Frauenforschung“ oder „Feministische Studien“ gepflegt wurde, waren die 1990er Jahre vom „Gender Turn“ geprägt – der Wendung hin zu den Gender Studies. Ich habe selbst zu einer Zeit begonnen, als darüber gestritten wurde, ob es legitim ist, von „Gender Studies“ zu sprechen, ob damit nicht eine problematische Wendung hin zum „Unpolitischen“ passiert. Aber wie man sieht: Der Begriff hat sich ziemlich durchgesetzt, und die Gender Studies sind politisch wie eh und je.
Was macht die Legal Gender Studies aus?
Legal Gender Studies analysieren und kritisieren die Art und Weise, wie Recht Geschlecht aufnimmt, konstruiert und wie es versucht, die Geschlechterwelt zu gestalten – traditionell im Sinne einer Ordnung, die von der natürlichen Gegebenheit zweier Geschlechter ausgeht. Lange Zeit war dies als ausgesprochenes Herrschaftsverhältnis von Männern über Frauen institutionalisiert – im öffentlichen wie im privaten Leben, insbesondere in Form der patriarchalen Ehe. Trotz der vielfältigen Änderungen der letzten Jahrzehnte gibt es jede Menge Restbestände und Nachwirkungen, die einer kritischen Auseinandersetzung bedürfen. Legal Gender Studies gehen aber noch tiefer: Wir kommen auf die Welt und bekommen im Geburtenbuch als erstes einen Personenstand verpasst, in dem ein Geschlecht fixiert wird. Einmal festgelegt ist er nur schwierig zu ändern und kann von Rechts wegen nur einer von zweien sein. Von der Idee her will uns das Recht im Hinblick auf unser Geschlecht als statische Wesen haben, die sich in bestimmte Rollen einfügen. Die Legal Gender Studies knüpfen hier an, hinterfragen angebliche Notwendigkeiten und versuchen, alternative Sichtweisen zu etablieren, um mehr Entfaltungsspielräume für jene zu eröffnen, die sich dem starren Zweigeschlechtersystem nicht unterwerfen wollen. Insbesondere geht es darum, Argumentationen zurückzuweisen, die behaupten, eine Regelung müsse so oder so sein. Denn das Recht operiert ganz gerne mit Notwendigkeiten. Früher hat es ja vor lauter Natur nur so geschwirrt: Was musste man nicht alles machen, nur weil es die Natur vorgibt. Im Recht ist aber nichts naturgegeben; und die Natur des Geschlechts ist ein Unsinn, die gibt es nicht.
Wie waren die Reaktionen von Personen aus ihrem Umfeld, als sie von Ihrem Forschungsschwerpunkt erfahren haben?
Ich habe in den frühen 1990er Jahren damit begonnen, Legal Gender Studies zu betreiben. Sich in dieser Zeit mit so etwas zu befassen, war eher ungewöhnlich. Mein unmittelbarer Dienstvorgesetzter hat mich dabei aber nicht behindert. Bisweilen hat er zwar gesagt, ich müsse aufpassen, nicht auf Gender-Fragen reduziert zu werden, sodass es heißt: „Die Holzleithner macht eh nur diesen feministischen Kram“. Ich sollte eben verschiedene Standbeine haben; dass eines davon Legal Gender Studies war, war dann durchaus in Ordnung.
Solche Orchideenfächer werden stets etwas schief angeschaut. Haben sich die Gender Studies mittlerweile in der Wissenschaft etabliert?
Sie haben heute zumindest eine gewisse Selbstverständlichkeit bekommen. Gender Studies werden wahrgenommen, anerkannt und nicht mehr automatisch verhöhnt. Auch für die Fakultät ist es sicherlich nicht schlecht, da man mit diesem Schwerpunkt eine gewisse internationale Bekanntheit erreicht. Es gibt aber keinen allgemeinen Konsens darüber, dass jede_r unbedingt Gender Studies lehren oder dass die Gender-Dimension in jedes Fach integriert werden muss. Aus einer gendersensiblen Perspektive wäre es selbstredend wünschenswert, wenn es im Sinne einer Fragestellung auch in die konventionellen und damit einhergehend auch in die stärker von Macht durchsetzten Bereiche eindringt. Das ist meinem Eindruck nach bisher nicht gelungen.
Woran liegt es eigentlich, dass man in den Gender Studies fast nur Frauen antrifft? Fehlt Männern dafür das Problembewusstsein?
Ich denke, viele männliche Kollegen haben den Eindruck, dass Problemstellungen der Legal Gender Studies mit ihnen nichts zu tun haben. So auf die Art: Das ist Feminismus, und Feminismus ist für Frauen. Außerdem haben Gender Studies immer noch den Ruf, dass Frauen sich als Opfer gerieren und nur auf die Männer drauf hauen. Dem möchte man sich als männlicher Kollege nicht aussetzen. Und das ist ja nicht vollkommen falsch. Ich mache in meinem Legal-Gender-Studies-Kurs immer einen Durchgang durch feministische Theorien. Darunter sind Sachen, die für einen Mann wirklich starker Tobak sind, etwa radikal-feministische Theorien wie die Dominanztheorie von Catharine MacKinnon: Männer dominieren Frauen, verdinglichen Frauen und machen sie zum sexuellen Objekt. Ich versuche das dann immer als Herausforderung, als Provokation für das eigene Denken darzustellen und nicht als individuelle Anklage. Zudem thematisiere ich in diesem Zusammenhang etwa Rassismusvorwürfe an feministische Theorien und Politiken, damit es nicht so wirkt, als könnte es sich eine Feministin in einer Hängematte aus Selbstgerechtigkeit gemütlich machen.
Sind denn diese Zuschreibungen von Geschlecht und Geschlechterrollen prinzipiell negativ?
Es gibt sowohl positive Geschlechterstereotype als auch negative. Ich persönlich finde sie immer problematisch, weil auch ein positives Stereotyp Menschen in ein Korsett schnallt. Das klassische weibliche Geschlechterstereotyp besteht darin, dass Frauen so wunderbare Softskills besitzen, also sozial intelligent, emotional kompetent usw. sind. Das unterscheidet angeblich Männer von Frauen. In der Praxis der Gleichbehandlung habe ich die Softskills aber eher anders wahrgenommen. Ich habe nie erlebt, dass man bei einer Frau gesagt hat: Wir müssen die unbedingt befördern, denn sie hat tolle Softskills. Wenn man den Softskills überhaupt Beachtung schenkt, dann weil sie einer Frau angeblich fehlen: Und das ist dann ein Problem. Bei Männern dagegen wird davon ausgegangen, sie seien Trampel und besäßen von Natur aus eher keine Softskills. Auch dieses Bild ist in Wahrheit natürlich eine totale Zumutung. Doch wenn es darauf ankommt, erscheinen Softskills bei Männern als besonderer Vorteil. Diese scheinbar positiven Stereotype können also manipulativ und benachteiligend eingesetzt werden. Nicht nur deshalb sehe ich solche Korsette prinzipiell problematisch.
Besteht dabei nicht auch immer die Gefahr, dass die Gender Studies in die Autonomie derjenigen Menschen eingreifen, die sich dennoch mit konventionellen Rollenbildern identifizieren?
Das ist in der Tat ein alter Vorwurf, der wohl nicht ganz unberechtigt ist. Die Gender Studies sind ein Teil einer Gender-Avantgarde. Sie werden betrieben von Menschen, die mit dem Zustand der Gesellschaft nicht zufrieden sind. Dieser Zustand wird eben von denjenigen befördert, die innerhalb der herrschenden Konventionen leben. Wenn die Gender Studies kritisieren, dann ist mit der Kritik an den Konventionen letztendlich auch eine an Trägern und Trägerinnen dieser Konventionen verbunden. Als frisch erweckte Jungfeministin (lacht) hab ich auch geglaubt, dass ich meinen Tanten erklären muss, dass die Art, wie sie ihr Leben führen, aus feministischer Sicht völlig verwerflich sei; das hab ich nicht lange gemacht. Jeder Mensch muss sich in irgendeiner Art und Weise mit dem eigenen Leben versöhnen. Es wäre dann quasi Zwangsemanzipation, wenn man anderen vorschreiben möchte, wie sie ihr Leben zu leben haben. Das ist eine furchtbare Haltung. Was man aber kann, darf und soll ist Fragen stellen. Zum Beispiel an die Bedingungen, die Menschen dazu motivieren, ihr Leben so oder so zu führen.
Haben die wissenschaftlichen Erkenntnisse aus den Legal Gender Studies konkrete Auswirkungen auf die gesellschaftliche Praxis?
Das konkret festzumachen ist natürlich eher schwierig. Sicher haben sich durch den Einfluss avancierterer Vorstellungen von Geschlecht auch gesellschaftliche Haltungen verändert. Dies fließt in die Gesetzgebung, in die Rechtsprechung und auch in die Ausbildung an rechtswissenschaftlichen Fakultäten ein. Noch vor 30 Jahren hat eine große Unsensibilität und Ignoranz gegenüber den Rechten von Frauen geherrscht. Als in Österreich in den 1970er Jahren die Eherechtsreform anstand, waren gerade die Professoren der Wiener rechtswissenschaftlichen Fakultät geschlossen gegen das Prinzip der Partnerschaftlichkeit. Das Abendland werde untergehen! Die Gerichte würden zusammenbrechen! Denn wenn der Mann nicht mehr als Haupt der Familie existiert, kämen alle Ehestreitigkeiten vor Gericht und unser ganzes Rechtssystem werde zerbröseln. Und die, die so argumentiert haben, waren keine Greise, sondern viele von ihnen waren gerade in ihren Dreißigern. Solche Positionen werden mittlerweile nicht mehr vertreten.
Mittlerweile ist Frauenfeindlichkeit ja nicht mehr konsensfähig. Welchen Zweck haben Regelungen wie gesetzliche Frauenquoten, wenn eine Geschlechterdiskriminierung ohnehin verboten ist?
Die Debatte über die Frauenquote wird nicht abgeschlossen sein, so lange die Frauenquoten in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen derart niedrig sind. Dort, wo sie ohnehin sehr niedrig sind, ist es für Frauen auch schwieriger hineinzukommen. Eine gesetzliche Quote dient quasi als „Eisbrecher“ gegen eingefrorene Strukturen, um eine kritische Masse von qualifizierten Frauen in diese Bereiche hineinzumanövrieren: Diese soll dazu führen, dass es dort zu einer Änderung der Kultur kommt und es selbstverständlicher wird, dass diese Bereiche diverser sind. Aber es geht ja nicht nur um Frauen. Wenn man sich die Herren anschaut, die in den Vorständen das Sagen haben, kann man eine sehr hohe Homogenität feststellen: altersmäßig, statusmäßig, etc. Glücklich ist man mit einer Quotenregelung aber nie. Ihre Beliebtheit hält sich bei beiden Geschlechtern in Grenzen. Viele Frauen sagen: Wenn es die Quotenregelung gibt und ich etwas erreiche, wird es immer heißen, dies sei nur der Quote zu verdanken.
An der Medizinischen Universität in Wien gab es vor nicht allzu langer Zeit heftige Diskussionen um den Aufnahmetest, bei dem Bewerberinnen ein Punktebonus eingeräumt wurde…
Das ist eine ganz unleidige Geschichte. Dieser Aufnahmetest hat statistisch hochsignifikante Benachteiligungen für Frauen gezeigt. 60 Prozent derjenigen, die den Test gemacht haben, waren Frauen und 40 Prozent waren Männer; erfolgreich waren dagegen 60 Prozent Männer und nur 40 Prozent Frauen. Jetzt kann man sich zurücklehnen und sagen: Die Frauen sind eben einfach nicht so gescheit oder jedenfalls für das Medizinstudium nicht so geeignet. Oder man schaut sich an, was genau das Problem ist. Die Wiener Medizin-Uni hat herausgefunden, dass es offensichtlich ein Übergewicht an Fragen gab, die mit dem räumlichen Vorstellungsvermögen zu tun hatten, das typischerweise stärker bei Männern ausgeprägt ist – aus welchen Gründen auch immer. Da muss man auch immer aufpassen: Vielleicht trainieren es die Männer einfach mehr, weil sie in der Schule eher darstellende Geometrie besuchen usw. Das Übergewicht solcher Fragen hat für die niedrige Frauenquote gesorgt. Man wollte das ausgleichen, indem man einen Bonus für Frauen einführt, gleichzeitig wurde aber auch versucht, den Test so zu überarbeiten, dass in Zukunft keine Gender-Bias mehr vorhanden ist. Aber was war das für ein Gezeter! Das war schon ironisch: Als der Test ein paar Jahre davor eingeführt wurde, haben sich alle darüber aufgeregt: Das sei ein Blödsinn, so ein Test habe überhaupt keine Aussagekraft, ein Test solle nicht über das Schicksal von Menschen entscheiden. Dann war dieser Test da und man hat versucht, ein bisschen etwas nachzujustieren, weil die Abweichung einfach so signifikant war. Und plötzlich war der Test sakrosankt und alle haben gesagt: „Die Ausbildung wird zusammenbrechen, wenn die schlechter qualifizierten Frauen an die Uni kommen!“ Ich habe mir gedacht: „Geht’s noch? Haben jetzt alle einen akuten Schwund an Erinnerungsvermögen?“ Man kann das natürlich auf verschiedenen Ebenen kritisieren, aber die Hysterie, mit der das diskutiert wurde, war schon außergewöhnlich.
Diese Hysterie hat vielleicht auch damit zu tun, dass man in weiten Teilen der Gesellschaft des Geschlechterthemas überdrüssig ist…
Ja, natürlich. Das Ende der Geschlechterdebatten wird ja regelmäßig ausgerufen, weil angeblich Frauen ohnehin schon gleichgestellt sind. Spannend ist aber doch diese Ungleichzeitigkeit: einerseits der angesprochene Überdruss – das Thema hängt vielen zum Hals raus, weil es ja auch so redundant ist, es sind immer die nämlichen Probleme. Andererseits erträgt man aber auch viel, so ganz nebenbei, fast ohne es zu merken. Das hat man beispielsweise an der Debatte gemerkt, die in Deutschland nach der Veröffentlichung der Brüderle-Geschichte losgegangen ist. Da haben sehr viele Frauen gesagt: Wir haben das so satt – nach all diesen Jahren müssen wir uns immer noch mit all diesen Blödigkeiten herumschlagen… Mit dem Recht kann man dem nur sehr schwer beikommen.
Soll das Recht letztendlich keine Rücksicht mehr auf das Geschlecht nehmen müssen oder ist eine besondere Berücksichtigung immer notwendig?
Wenn wir uns die Frage stellen, ob und in welcher Weise geschlechtliche Emanzipation durch das Recht möglich ist, befinden wir uns immer in einem Dilemma der Differenz. Einerseits haben wir noch ungleiche Regelungen im Recht und eine Angleichung wäre ein Ziel. Aber wenn man alles gleich regelt, lässt man dort, wo Unterschiede gelebt werden, in Wahrheit Leute im Stich. Andererseits besteht bei unterschiedlichen Regelungen immer die Gefahr, dass man Stereotype festschreibt. Bei Quotenregelungen entsteht zum Beispiel das Stereotyp: Frauen sind „Tschoperln“, die Quotenregelungen brauchen. Jede Regelung, die differenziert, erzeugt bestimmte Standards, die dann ein Korsett bilden können. Ich glaube, die Vorstellung eines Rechts, in dem auf das Geschlecht überhaupt nicht mehr Bezug genommen wird, ist unwahrscheinlich und auch nicht dienlich. An bestimmten Stellen ist es notwendig, dass das Recht an das Geschlecht anknüpft. Trotzdem sollte das Recht von Geschlechterfixierungen wegkommen, wo sie nicht notwendig sind, wie zum Beispiel beim geschlechtlichen Personenstand.
Woran liegt es, dass man an der Praxis einer dualen und endgültigen Geschlechtszuschreibung so vehement festhält?
Weil das so eine starke, intuitive Richtigkeit zu haben scheint und Geschlecht ein Merkmal ist, mit dem man sich stark identifiziert. Männlichkeit und Weiblichkeit kann man dekonstruieren, man kann darüber streiten – aber wenn man im eigenen geschlechtlichen Selbstverständnis attackiert wird, geht das sehr tief. Die Frage, welchem Geschlecht man angehört, ist etwas ganz Fundamentales für die meisten Menschen. Da krallt man sich dann irgendwie fest, denn eine rechtlich fixierte Geschlechterordnung hat etwas Beruhigendes.
Geschlecht ist auch ein Riesengeschäft. Sehen Sie sich die geschlechterdifferenzierte Marktwirtschaft an: Wir werden permanent geschlechtlich kodiert. Es geht in jeden kleinsten Winkel dessen, was Menschen tun, wie sie es tun, was sie anhaben etc. Genau deshalb bin ich überhaupt nicht optimistisch, was den Erfolg einer breitenwirksamen Geschlechterdekonstruktion anbelangt.
Noch einmal zum Dilemma der Differenz: Hat das Recht ein grundsätzliches Problem damit, Geschlecht adäquat beschreiben zu können?
Das Recht knüpft immer an vermeintliche Selbstverständlichkeiten an, zum Beispiel an die Unterscheidung zwischen männlich und weiblich in der Medizin. Das Recht versucht aber auch, bei Herausforderungen auf der Höhe der Zeit zu bleiben. Man kann derzeit beobachten, dass sich die früheren, sehr dichotomisierenden Vorstellungen in der Medizin und in der Psychiatrie zunehmend auflösen. Die Tatsache, dass die Medizin hier flexibler wird und mehr auf die Wandelbarkeit von Geschlechtsidentifikation im Laufe des Lebens eingeht, wird in ganz erstaunlicher Weise vom Recht aufgegriffen. Wenn Sie sich anschauen, was das Bundesverfassungsgericht in den letzen Jahren daraus gemacht hat: zum Beispiel die Aufhebung des Sterilisationsgebotes als Voraussetzung für den Wechsel des Personenstandes. Da hat sich viel getan. Was als biologisches Geschlecht angesehen wird, wird in der Medizin mittlerweile als „Gender of Assignment“ bezeichnet. Da gibt es Wechselwirkungen zwischen Medizin und Recht.
Welche Bedeutung hat eine gendersensible Sprache für die Wahrnehmung und die Dekonstruktion von Geschlecht?
Ich persönlich halte sie für enorm wichtig. Aus dem einfachen Grund: Sprache schafft Welt. Die Art, wie man sich ausdrückt, erzeugt Bilder in Köpfen und die Bilder in den Köpfen formen Wahrnehmung, Ideen und Vorstellungen. Ein Beispiel aus einer Lehrveranstaltung in Verwaltungsrecht Mitte der 1990er Jahre: Ich habe mich damals schon um eine gendersensible Sprechweise bemüht und habe eben gesagt: „der Landeshauptmann oder die Landeshauptfrau“ und „Bezirkshauptmann oder Bezirkshauptfrau“. Nach zehn Minuten hat sich dann eine Studentin gemeldet und meinte, sie habe jetzt das erste Mal in ihrem Leben die Vorstellung gehabt: Landeshauptfrau oder Bezirkshauptfrau, das wäre etwas, was sie auch werden könnte. Das gilt überall. Wenn wir immer nur „der Arzt“ sagen – und natürlich auch „die Krankenschwester“ – dann passieren Zuständigkeits- und Rollenzuweisungen. Das heißt nicht, dass es keine Ärztinnen geben kann. Aber das Bild der kompetenten Figur „Arzt“ ist ein Mann. Wenn dann eine Ärztin kommt, hat das nicht dieselbe Selbstverständlichkeit.
Das heißt jetzt nicht, dass man in jeder Sekunde ganz korrekt sein und alle Formen verwenden muss. Man kann ja sogar noch weiter gehen und darauf sagen: Wenn ich gendersensibel spreche und immer beide Geschlechter benenne, lasse ich auch etwas aus, denn dann tue ich so, als gäbe es nur Männer und Frauen. Es ist wichtig, das zu sehen, man darf sich selbst aber auch nicht überfordern. Es geht darum, Akzente zu setzen und kreativ damit umzugehen.
Hat Sprache oder die deutsche Sprache generell ein Defizit, weil sie „männlich“ ausgerichtet ist?
In der deutschen Sprache ist es vielleicht besonders mühsam. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, die Vielfalt der Geschlechter zu berücksichtigen, zum Beispiel mit einem „stockenden“ –innen, das sozusagen einen Raum öffnet für andere Geschlechter. Aber das ist etwas Avantgardistisches; das heißt, es ist in den Köpfen der Menschen, die das tun, aber es ist nur bedingt vermittelbar. Diese Problematik wird immer bestehen. Doch allein durch das Bewusstsein dafür ist schon viel gewonnen. Aber vor rigoristischen Dogmatismen gruselt es mir selber. Das macht nichts besser, da wird alles nur eng. Man sollte versuchen, im Sinne eines gemeinsamen Bemühens um ein angenehmes Zusammenleben Wege zu finden, sich wechselseitig zu respektieren. Und nicht ignorant zu sein. Denn vielleicht liegt gerade da, wo ich selbst einen Rigorismus sehe, ein Problem, für das ich bislang blind war – dafür muss ich sensibel sein. Ebenso wie ich Dogmatismen ablehne, finde ich Ignoranz ganz schrecklich: wenn alles nur als hinrissiger Unsinn abgetakelter, humorloser Feministinnen hingestellt wird, die uns vorschreiben wollen, wie wir sprechen sollen. Solche Haltungen verfestigen letztlich herkömmliche Strukturen. Wenn man das gern möchte und dazu steht, dann bitte. Wenn man dafür kritisiert wird, sollte man sich aber auch nicht wundern.