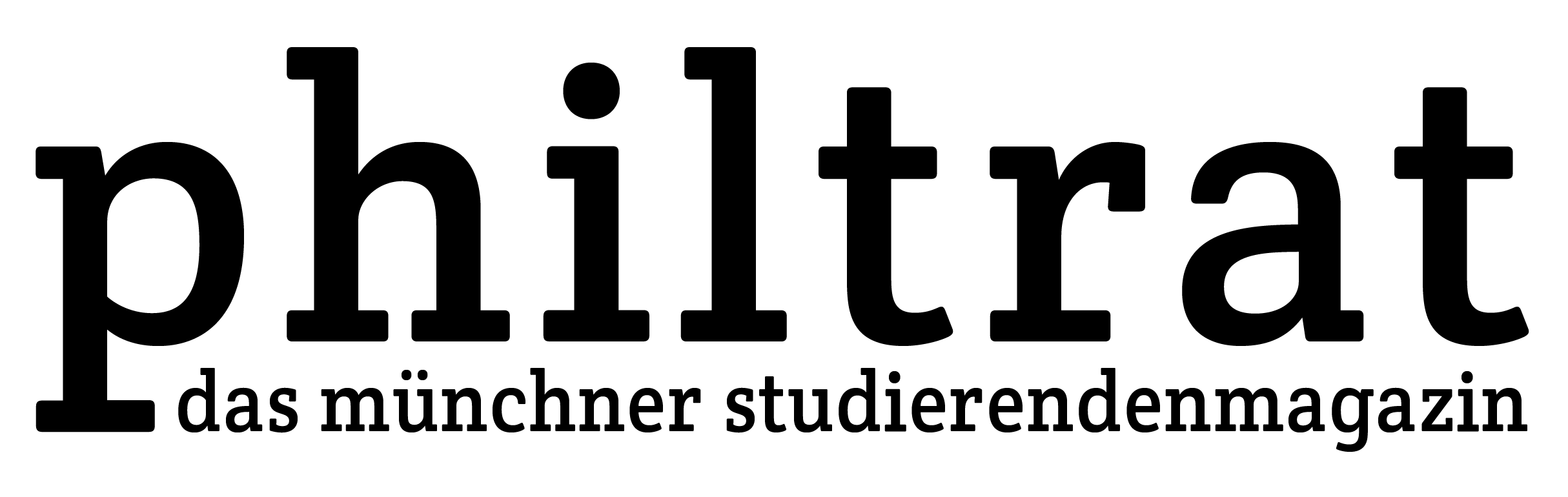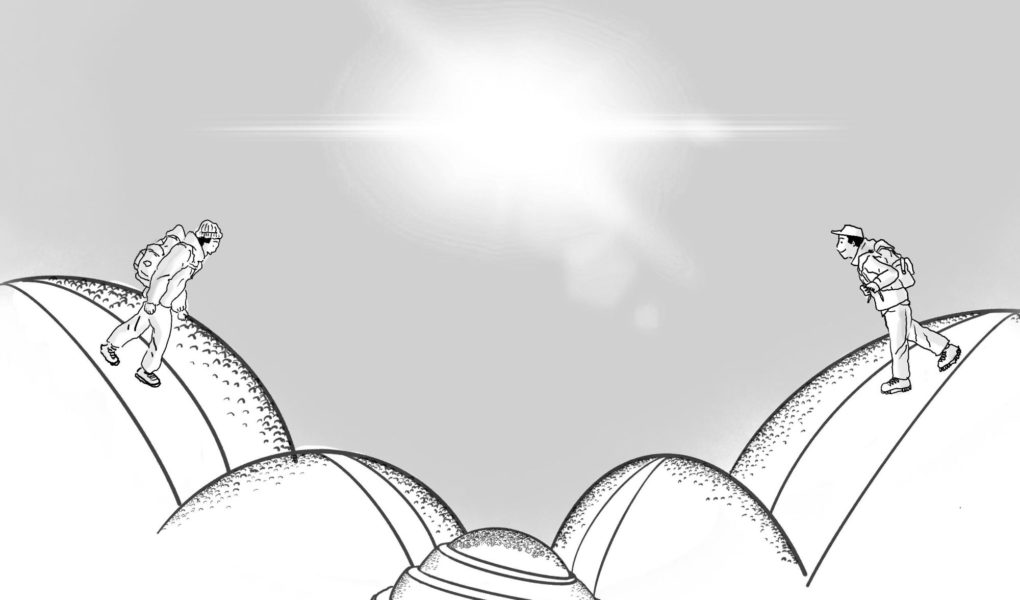Dass unsere Gesellschaft zerfällt, scheint für viele heute eine ausgemachte Sache. Doch die Realität ist komplexer. Warum wir trotz aller besorgniserregender Konflikte und Herausforderungen nicht dem Katastrophendenken verfallen dürfen. Ein Kommentar.
Von Felix Meinert
Puh. Unsere Gesellschaft ist erschöpft. Gereizt und wütend, orientierungslos und eben deshalb erschöpft.
Und um die kollektiven Nerven aufs Neue zu strapazieren, kommt jetzt mal wieder so ein Text zur umfassenden Krise unserer Gesellschaft. Denn selbst wenn wir uns scheinbar auf nichts mehr einigen können, können wir uns zumindest darauf einigen. Wir steuern auf einen neuen Konsens zu: nämlich, dass es keinen Konsens mehr gibt.
Doch diese Einschätzung ist ebenso verkürzt wie voreilig. Ja, die Demokratie steht in Deutschland ebenso wie im gesamten politisch-kulturellen Westen unter Druck. Politisch motivierte Angriffe haben im vergangenen Jahr erneut zugenommen. Politiker*innen aller Parteien werden immer häufiger eingeschüchtert, bedroht und körperlich attackiert. Seit dem 7. Oktober haben antisemitische und islamfeindliche Vorfälle zugenommen. Und die rechtsextremen Strukturen einer im Bundestag vertretenen Partei kommen immer deutlicher zum Vorschein.
Aber am Abgrund? Unmittelbar vor dem Zerfall? Das ist unsere Gesellschaft nicht. Und es wäre wichtig, dieses Bewusstsein zurückzuerlangen.
Sind wir wirklich so gespalten?
Immer wieder stoßen wir auf allerlei Untergangsszenarien und Spaltungsdiagnosen – vorangetrieben nicht nur durch soziale Medien und die Boulevardpresse, sondern auch durch seriöse Journalist*innen, Aktivist*innen und Vertreter*innen politischer Parteien. Jüngst rief etwa Eva Menasse in der ZEIT zu mehr Gelassenheit im gesellschaftlichen Diskurs auf, stellte dem jedoch die unheilverkündende These voran: „Die Gesellschaft zerbricht.“
Dabei ist die Realität komplexer. Der Soziologe Steffen Mau und zwei wissenschaftliche Kollegen unterzogen die These, unsere Gesellschaft sei polarisiert, einer empirischen Analyse. Das Ergebnis: Unsere Gesellschaft spaltet sich bei konfliktbehafteten Themen keineswegs in zwei starre, einander entgegengesetzte Lager. Doch Mau, der drei Jahre lang für die Bundesregierung im Sachverständigenrat für Migration saß, identifizierte sogenannte „Triggerpunkte“ in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung: also Detailfragen, auf die Diskursteilnehmende oft mit besonders starkem Affekt reagieren. Gendern, Tempolimit, Clan-Kriminalität.
Diese Themen triggern deshalb so stark, weil anhand ihrer Aushandlung wahrgenommene Verhaltenszumutungen, Normalitätsverstöße und Ungleichbehandlungen zu Tage treten. Weil viele Menschen so emotional und impulsiv auf diese Schlagwörter reagieren, fällt es ihnen schwer, die Vielschichtigkeit der dahinterliegenden Themenkomplexe im Blick zu behalten. So prallen in der Debatte um genderneutrale Sprache Ansprüche an die Sichtbarmachung von Frauen und sexuellen Minderheiten auf die Angst um Eingriffe in die individuelle Redefreiheit. In der kleinen Endung „*innen“ verdichtet sich die Infragestellung einer gesamten etablierten Ordnung. Und weil es kaum möglich erscheint, die dahinter liegenden Phänomene in ihrer Komplexität zu verstehen oder gar zu vereinen, entstehen stattdessen Antagonismen. Das Für und das Wider. „Alte weiße Männer“ gegen „Woke“. Patriarchat gegen „Gender-Gaga“.
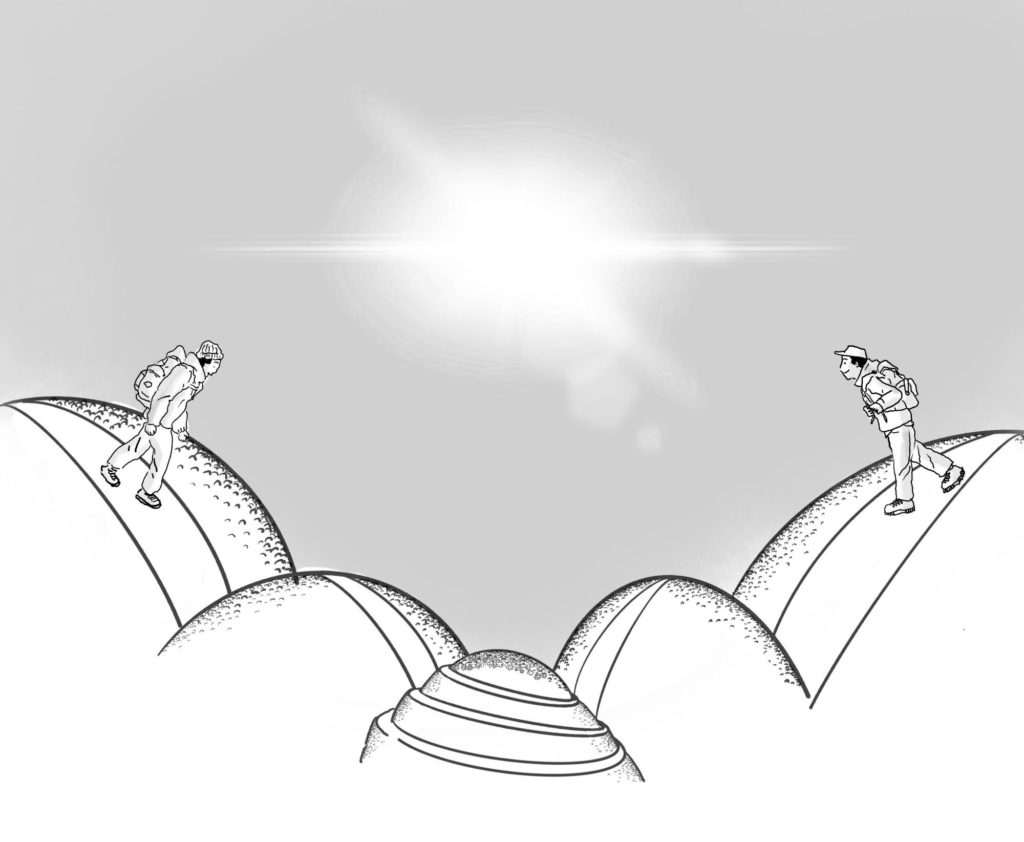
So herausfordernd und invasiv uns diese Mikrodebatten erscheinen mögen – es wäre ein Fehler, uns auf ihre Antagonismen zu versteifen. Denn der Kulturkampf im Kleinen lenkt von der tatsächlich gestiegenen Pluralität der Identitäten, Meinungen und Ansprüche im gesellschaftlichen Aushandlungsprozess ab. Es mag Kraft kosten, uns auf diese Widersprüchlichkeit und Unübersichtlichkeit einzulassen. Doch diese Kraft ist besser in die Akzeptanz von Grauzonen investiert als in die Förderung eines vermeintlich einfacheren Schwarz-Weiß-Denkens, das uns emotional immer wieder aufs Neue aufheizt.
Die Bundesrepublik ist nicht Weimar
Damit verbunden ist auch die Absage an die heute so populären Katastrophen- und Rettungserzählungen. In einer Gesellschaft, die so komplex ist wie die unsere, sind diese Narrativen zwar verheißungsvoll, aber faktisch untragbar. Klimawandel, Krieg, Extremismus: Die Herausforderungen unserer Zeit sind massiv, und es braucht darauf entschiedene Antworten. Doch diese dürfen weder von politischer Vereinseitigung geleitet sein, noch von der Panik vor einem sich stetig verkürzenden Handlungshorizont.
Denn wenn die Demokratie ständig in Gefahr ist, lässt es sich nicht nur rechtfertigen, möglichst radikale Töne anzuschlagen und möglichst drastische politische Maßnahmen zu ergreifen – es erscheint beinahe als Notwendigkeit. Dann legitimieren wir Freiheitseinschnitte von vornherein dadurch, dass diese ja „alternativlos“ seien, wenn wir Interesse am Bestand unserer Gesellschaftsordnung, unseres Friedens, unserer Existenz hätten. So könnte die Rede vom Zerfall unserer Gesellschaft vielleicht irgendwann zur self-fulfilling prophecy werden.
Bevor wir also in den Chor der dem Untergang Geweihten einstimmen, sollten wir einmal innehalten. Versuchen, die Dinge aus der Distanz zu betrachten. Uns bewusst machen, dass trotz Fragmentierung, Extremismus und politisch motivierter Gewalt Deutschland 2024 nicht Weimar 1924 ist. Im Gegensatz zu jenem demokratischen Pilotprojekt verfügt die heutige Bundesrepublik nicht nur über den verfassungsrechtlich geschützten Grundsatz der wehrhaften Demokratie und stabile politische Institutionen, sondern auch über eine jahrzehntelang gereifte demokratische Kultur. Diese können wir bewahren, indem wir für sie an der Wahlurne und auf der Straße einstehen. Aber auch indem wir auf ihre Stabilität vertrauen.
Dann könnten wir vielleicht wirklich durchatmen.